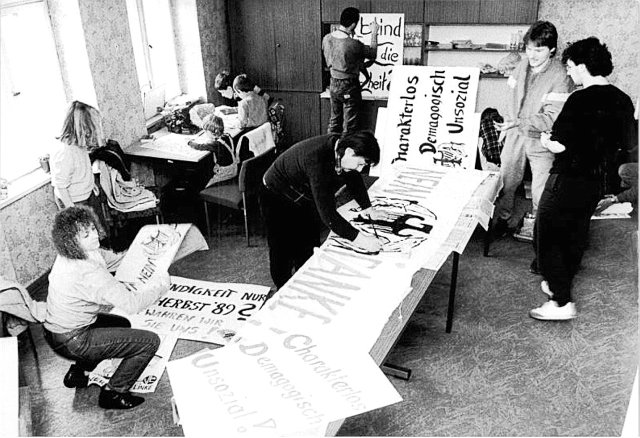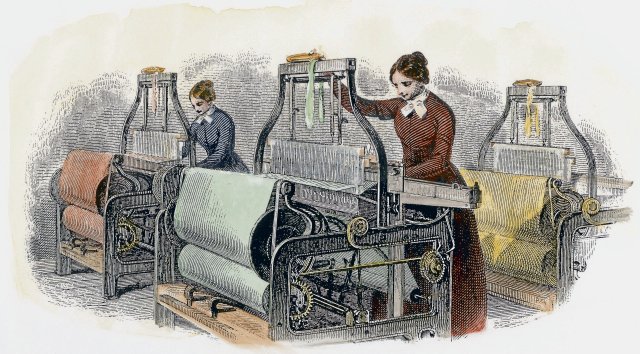Tongas König Tupou IV. brachte einst 201 Kilo auf die Waage. Und ließ damit sogar Helmut Kohl neben sich - relativ - schlank aussehen. Doch der König ist nicht der einzige Dicke im Land. Einer Schätzung zufolge leiden 60 Prozent der Tonganer an krankhaftem Übergewicht.
Im Königreich Tonga steht es sogar auf dem Münzgeld: » Fakalahi me akai« - mehr essen. In der Tat gibt es im Südpazifik einen Zusammenhang zwischen Geld und Körpergewicht. Dick sein gilt als Ausdruck des Wohlstands.
In der über 4000 Jahre alten, streng hierarchischen polynesischen Kultur wurden Clanchefs und Stammesführer von ihren Untertanen stets bestens versorgt. Ihre Körperfülle entwickelte sich zum Zeichen ihrer Macht. So entstand wohl schon in alter Zeit ein eigenartiges Schönheitsideal.
Lami Mano entspricht diesem Ideal: Der 63-jährige Clanchef führt einen Matai-Titel auf Samoa - Dorf-adel gewissermaßen. Er ist Bürgermeister seines Heimatortes Siumu und Besitzer von 8000 Palmen, die ihm Wohlstand gebracht haben. Und den hat er in Körpergewicht investiert. Er weiß nicht, wie schwer er ist, in der Südsee steigt man nicht täglich auf die Waage. Vielleicht wiegt er 150 Kilo, sein Bauch drängt sich aus dem Hemd, hängt über die Hose. Lami Mano schwitzt heftig beim Kokosöl-Pressen, aber er ist gut drauf. Seine Aufgabe als Bürgermeister? »Ich kümmere mich um das Wohlergehen des Dorfes. Und darum, dass alle genug zu essen haben!«
Dr. Wolfgang Losacker, deutscher Internist auf der Cook-Insel Rarotonga, weiß von einer genetischen Besonderheit der Menschen in der Südsee, die in alter Zeit wichtig war: »Das Unterhaut-Fettgewebe ist deutlich stärker ausgeprägt als bei Menschen aus dem Abendland.« Wenn genügend Nahrung vorhanden war, aß sich auch das einfache Volk dick und rund. Die angefutterten Reserven erlaubten lange Seereisen in Auslegerkanus, um neue Inseln zu besiedeln, wo das Nahrungsangebot zunächst beschränkt war. Denn die für die Ernährung wichtigen Pflanzen wie Kokospalmen, Taro, Süßkartoffeln mussten auf den zuvor unbesiedelten Inseln erst angepflanzt werden. Dank der Fettreserven überlebte man auch den plötzlichen Nahrungsmangel nach den im Südpazifik häufigen Taifunen und nach zerstörerischen Inselkriegen.
Die Neigung, viel zu essen, wenn viel Nahrung zur Verfügung steht, hat sich bei den Polynesiern bis heute erhalten. Nur die durch äußere Faktoren bedingten Fastenperioden gibt es nicht mehr. »Es gibt Leute hier, die essen so viel, bis sie nicht mehr laufen können«, berichtet die Ärztin Mareva Tourneux aus Französisch-Polynesien, »die Leute essen zu viel Zucker, zu viel Fleisch, vor allem kalorienhaltige Nahrungsmittel aus den USA und Neuseeland.« Denn gesündere einheimische Produkte wie Fisch und Gemüse kosten mehr als importierte Konserven.
»Übergewicht ist das größte Gesundheitsproblem in der Gegenwart«, berichtet Dr. Henry Tikaka, Krankenhausdirektor auf Rarotonga. »Die Menschen haben hohen Blutdruck, erkranken an Diabetes, bekommen Herzinfarkte, Schlaganfälle.«
»Fett zu sein ist kein Problem für Polynesier«, erzählt dagegen Elisabeth Lai, Sozialarbeiterin in Tahitis Hauptstadt Papeete. »Wer dünn ist, gilt als krank.« Auch sie bringt das Übergewicht eines Großteils der Bevölkerung mit veränderten Lebensbedingungen in Zusammenhang. »Die dicken Menschen sind auch Opfer«, relativiert Gesundheitsstaatssekretär Vaine Teokotei auf den Cook-Inseln. Opfer der Werbekampagnen von Großkonzernen. Bewegungsmangel durch Motorisierung des Verkehrs komme hinzu.
Pemita Seuseu, Gesundheitsoffizier im Gesundheitsministerium von Samoa, erzählt vom typischen Tagesablauf der Samoaner: »Sie arbeiten hart. Ohne Frühstück wird von 8 bis 12 Uhr gearbeitet. Dabei verbrauchen sie viel Energie in der Hitze nahe am Äquator. Aber danach essen sie den ganzen restlichen Tag.« Es gebe zwar Statistiken über die Gewichtsentwicklung der Bevölkerung, aber die Zahlen würden unter Verschluss gehalten. Staatsgeheimnis Übergewicht.
Von makaberen Bemerkungen der Chirurgen im Operationssaal berichtet die deutsche Medizinstudentin Diane Marschall, die ein Praktikum im Krankenhaus der samoanischen Hauptstadt Apia absolvierte: »Einem übergewichtigen Diabetespatienten wurde auf dem Operationstisch gesagt, er sei selbst schuld, dass ihm ein Bein amputiert werde.« Dabei seien die Ärzte genauso dick gewesen wie der Patient selbst.
Aufklärungsprogramme zum Thema Ernährung und Übergewicht gibt es durchaus. »Im Krankenhaus hängt Informationsmaterial aus, im Schulunterreicht ist Ernährung ein Thema«, berichtet Mareva Tourneux über Tahiti. Und selbst der König von Tonga hat die Zeichen der Zeit erkannt. Der Monarch hat 75 Kilo abgenommen durch Diät und Betätigung im königlichen Fitnessstudio. Seit einiger Zeit fordert Tupou IV. seine Untertanen auf, dem Beispiel zu folgen und etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ob sie wohl auf ihn hören?
Die Siegerinnen der zahlreichen Miss-Wahlen in der Südsee sind jedenfalls üblicherweise gertenschlank. Viellicht aber ist das nur ein Zugeständnis an das Schönheitsideal im Rest der Welt, um den Gekürten die Chance auf internationale Titel zu geben.