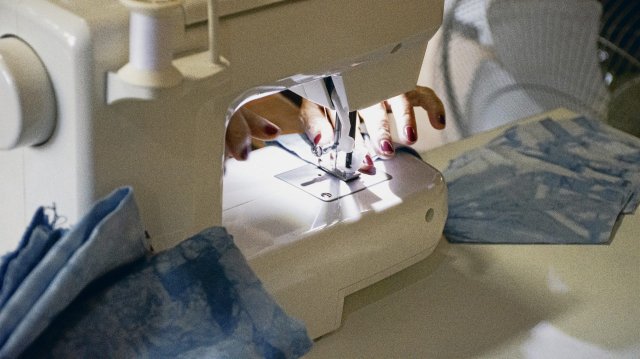- Wirtschaft und Umwelt
- Infektionskrankheiten
Pocken-Ausbruch in der Goldgräberstadt
Armut und Ausbeutung befördern die Ausbreitung des Mpox-Virus im Osten der Demokratischen Republik Kongo

Kamituga ist eine abgelegene Bergbausiedlung in der Provinz Süd-Kivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Wie viele Menschen hier leben, ist schwer zu sagen. Laut einer zehn Jahre alten Zählung lebten rund 14 000 Menschen in der Stadt. Aktuelle Schätzungen gehen eher von einer niedrigen sechsstelligen Zahl in der Gegend aus, die von ständigem Kommen und Gehen gekennzeichnet ist. Aus anderen Landesteilen sowie aus den nahe gelegenen Nachbarstaaten Ruanda, Burundi und Tansania zieht es junge Menschen zum Arbeiten hierher. Viele scheitern und wandern weiter, kehren aber auch immer wieder zurück.
In den schlammigen Hängen, in Schwemmland und Flussbetten rund um Kamituga wird nach Gold geschürft, meist im kleingewerblichen Bergbau. Die Arbeit ist gefährlich: Die bis zu 100 Meter tiefen Gruben sind ungesichert, ohne Schutzausrüstung wird das Erz gemahlen und unter Einsatz giftigen Quecksilbers verarbeitet. Es ist ein Millionengeschäft für die Profiteure, die das Gold meist über die Grenzen schmuggeln, bis es zuletzt in Dubai landet; aber die Bezahlung ist nur im Erfolgsfall einigermaßen gut, wie Betroffene berichten. Ein Monatslohn bei einfachen Tätigkeiten liegt umgerechnet bei 60 bis 100 US-Dollar. Am unteren Ende der Hierarchie stehen Kinder und auch Frauen. Viele verdingen sich als Sexarbeiterinnen.
Schlagzeilen machte Kamituga normalerweise nur durch Unglücke – etwa regelmäßige Erdrutsche oder den Einsturz einer Goldmine, bei dem vor einigen Jahren mindestens 50 Arbeiter starben. Das änderte sich im September 2023, als die Gesundheitsbehörden dort einen ungewöhnlichen Mpox-Ausbruch meldeten, der mit dazu beitrug, dass die Weltgesundheitsorganisation vergangene Woche den Notstand ausrief. Zwar leiden hier viele Menschen unter Infektionskrankheiten wie Malaria; auch Anämie infolge von Mangelernährung ist verbreitet. Aber dieses Pockenvirus war in der Gegend zuvor noch nicht aufgetreten. Atypisch ist auch das Übertragungsmuster: Sexarbeiterinnen gehörten hier zu den ersten Betroffenen, obwohl die in Zentralafrika verbreitete Variante I bislang eher durch Kontakt zu Wildtieren übertragen wurde.
Sorge bereitet vor allem, dass es »zu einer anhaltenden Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen ist«, wie es in einer im Juni im Fachblatt »Nature« veröffentlichten Untersuchung eines Teams um Placide Mbala, Leiter der Abteilung für Epidemiologie am Nationalen Institut für biomedizinische Forschung der DR Kongo, heißt. Die Forscher nahmen eine Genomanalyse bei etwa 120 Proben vor. Diese zeigte laut den Angaben eine eindeutige Klade-I-Linie, die aber Mutationen aufweist und von zuvor zirkulierenden Stämmen in der DR Kongo abweicht.
Die Fälle mit der neuen, Klade Ib genannten, Untervariante aus dem Zeitraum bis Ende Februar beschränkten sich auf die Gesundheitszone Kamituga, wie die Autoren schreiben. Wie die Ausbreitung tatsächlich verläuft, bleibt aber unklar. Generell wird in Kongo nur bei wenigen Proben eine Genomsequenzierung vorgenommen, weil es an Laborkapazitäten, Personal und Geld fehlt. Da von den PCR-Tests in Kamituga fast 91 Prozent positiv waren, gehen Experten aber davon aus, dass nur ein Bruchteil der Infektionen tatsächlich entdeckt wird. Personen mit leichten Symptomen, zumal wenn die typischen Pusteln nicht sichtbar im Genitalbereich auftreten, gehen erst gar nicht zum Gesundheitszentrum, da sie sich eine Isolierung nicht leisten können. Gesundheitspersonal berichtet, dass viele weitere Menschen Mpox-Symptome haben, aber keine Behandlung suchen.
Mikrobiologe Mbala, der zu den wenigen Mpox-Experten weltweit gehört, geht aber davon aus, dass sich die Epidemie durch grenzüberschreitende Bewegungen für Bergbau- und Handelsfirmen ausbreitet, wie er dem Fachblatt »Lancet« sagte. »Darüber hinaus können Sexarbeiterinnen nach einem Arbeitsbesuch in der Bergbaustadt das Virus mit nach Hause nehmen.« In den Griff zu kriegen war der Ausbruch in Kamituga laut Mbala ohnehin nicht: Die örtliche Gesundheitsinfrastruktur sei nicht in der Lage, »eine großflächige Epidemie zu bewältigen, und der eingeschränkte Zugang zu externer Hilfe erschwert die Lage noch zusätzlich«.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.