- Kultur
- Staatsoper Hamburg
»Der Freischütz«: Kommt Zeit, kommt Wald
An der Staatsoper Hamburg feierte »Der Freischütz« in der Regie von Andreas Kriegenburg Premiere

Was», fragte Erich Fried einmal mit einem Gedicht, «ist uns Deutschen der Wald?» – um mehrerlei Antworten zu geben: «ein ewig grünender vorwand / zur definition von geräuschen / als rauschen oder als stille», aber auch «eine deckung für hochgefühle / die anderwärts nicht mehr gedeckt sind», «ein anlaß sich gelassen verlassen zu fühlen» und «eine gelegenheit / weg und holzweg in ihm zu bahnen», schließlich «ein grund in ihm zu lieben und in ihm zu schießen».
Ja, ja, der Wald, der deutsche zumal, ist Vorwand und Deckung, Weg und Holzweg, vor allem aber: ein endloser Grund. Seinen nicht gerade geringen Teil zu den Fantasien von der deutschen Sehnsuchtslandschaft Wald hat Carl Maria von Weber vor gut zweihundert Jahren mit seinem «Freischütz» beigetragen, der schnell Karriere als «Nationaloper» machen sollte.
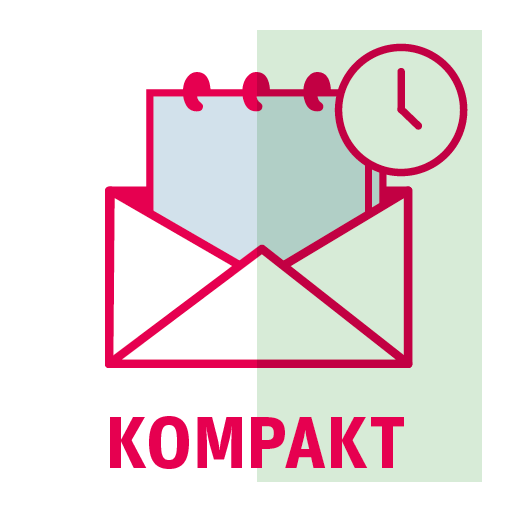
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Webers romantische Oper, 1821 in Berlin uraufgeführt, ist nun an der Staatsoper Hamburg unter der musikalischen Leitung von Yoel Gamzou in einer neuen Inszenierung in der Regie von dem verspielten wie feinsinnigen Regisseur Andreas Kriegenburg zur Premiere gekommen. Kriegenburg lässt die Zuhörer und Zuschauer durch das Programmheft wissen, ob es sich beim «Freischütz» nun um eine sogenannte Nationaloper handele oder nicht, das interessiere ihn nicht so sehr. Was sich aber dann von der Bühne in den Publikumssaal transportiert, durch die Musik ohnehin, spricht eine deutlich andere Sprache.
Der «Freischütz» ist nicht nur nach den Befreiungskriegen gegen das napoleonische Frankreich entstanden, sondern spielt auch in der Zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Regisseur verlegt nun das Geschehen in eine nicht genau bestimmbare Zeit zwischen den mehr oder minder goldenen 20er Jahren nach dem desaströsen Ersten Weltkrieg, an die die Maske in Stummfilmästhetik erinnert, und an die Tage des Wirtschaftswunders nach dem katastrophalen Zweiten Weltkrieg, an die die Kostüme (Andrea Schraad) erinnern. In die zivilisierteren Geschichtsabschnitte, die als Nachkriegs-, pessimistischer ausgedrückt: Zwischenkriegszeiten in die Annalen eingehen, schreiben sich archaische Traditionen, einer kriegerischen Welt entstiegen, immer weiter fort, so zeigt Kriegenburg deutlich auf.
Im «Freischütz» ist es der Jägerbursche Max, der, ehe er Agathe heiraten darf, einen Probeschuss abgeben soll. Diese Pflichtübung zur Demonstration der eigenen Potenz stürzt den Bräutigam in Verzweiflung, hat ihn doch das Jagdglück verlassen. Doch dann eilt, scheinbar zur Hilfe, Kaspar herbei, der ihn zum Pakt mit dem schwarzen Jäger Samiel in der Waldschlucht verführt. Unfehlbare Kugeln werden gegossen, von denen eine aber Agathe treffen soll.
Zum einen werden die Zwänge der Leistungsgesellschaft im Umfeld der Trachten- und Anzugträger vorgeführt, an denen Max (Maximilian Schmitt) gesanglich und spielerisch überzeugend zu zerbrechen droht. Zum anderen wird die Überkommenheit der Probeschusstradition erkennbar, die ein Relikt aus alter Zeit ist. Das martialische Ritual, das von Kaspar herbeigesehnte Todesopfer, die düstere Gestalt des Samiel sind nicht weniger düster als Webers Komposition und als der tiefschwarze Wald, der uns hier (Bühne: Harald B. Thor) als bewegliche Bretterwände präsentiert wird.
Dass in einer solchen Welt, die der Vergangenheit so unangenehm verhaftet bleibt, auch die Frauenfiguren zum Mittun und Geschehenlassen verdammt sind, verwundert nicht. Der Hamburger «Freischütz» unterläuft das sanft, indem die Agathe (Julia Kleiter) mit einer kraftvollen Sopranistin besetzt wird und das humoristische Potenzial in der Figur von dessen Vertrauter Ännchen (Alina Wunderlin) vollständig ausgeschöpft wird. Aber es bleibt dabei, die Rolle der Damen ist auf das Hoffen und Bangen und Winden des Jungfernkranzes beschränkt.
Den märchenhaften Schluss, den uns Weber beschert hat, nimmt Kriegenburg ernst und lässt ihn ironiefrei über die Bühne gehen. Der tödliche Schuss wird auf wundersame Weise umgeleitet, Max ist geläutert und mit dem Probeschuss soll es von nun an vorbei sein. So zeigt sich die Gesellschaft doch als wandelbar. Die Musik zumindest will es uns glauben machen.
Nächste Vorstellungen: 27., 29.11. und 3.12.
www.staatsoper-hamburg.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







