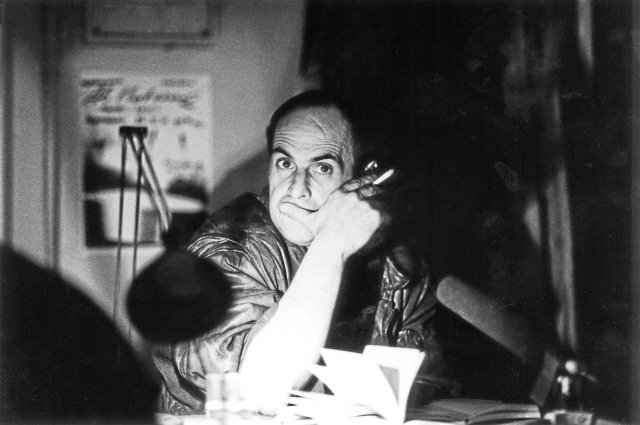- Kultur
- Berlinale
Jun Li und »Queerpanorama«: Trümmerlandschaft im Schlafzimmer
Berlinale Panorama: »Queerpanorama« zeigt zwischen schwulem Sex und ernstem Spiel mit den Identitäten eine kaputte Gesellschaft

Dass dieses Wort fallen würde – und zwar nicht zu selten –, war ja klar. »Identität« heißt es Mal um Mal. »Identität«, das ist seit ein paar Jahren das Lieblingswort in einem Diskurs, der keiner ist. »Identität« sagen die Leute immer dann, wenn es am politischen Argument mangelt. Dabei hat Heiner Müller doch bereits Anfang der 90er Jahre alles Notwendige in der Angelegenheit gesagt: »Identität ist doch Fiktion« und »Wer mit sich identisch ist, der kann sich einsargen lassen, der existiert nicht mehr, ist nicht mehr in Bewegung. Identität ist ein Denkmal.«
Ein wenig wie im intellektuellen Sarg geht es auch bei der Weltpremiere des Films »Queerpanorama« in der Sektion Panorama auf der 75. Berlinale zu. Der 33-jährige Regisseur Jun Li richtet vorab einige Worte an sein Publikum. Ein Schauspieler und Freund habe ihn gefragt, ob er seinen Filmbeitrag vom Festival nicht zurückziehen wolle, um sich damit mit der BDS-Bewegung zu solidarisieren. Da johlt ein Teil des Auditoriums erstmals lautstark. Li habe sich dagegen entschieden, habe er doch so hart dafür gearbeitet, hier sein zu können. In der Sache ist er wohl doch dafür, nur kosten soll es ihn nichts.
Geschenkt ist dann auch das Statement des Schauspielers, das er nicht unter Verschluss halten möchte. Aufgrund der politischen Situation in Deutschland wolle er die Videobotschaft allerdings nicht abspielen, sondern den Brief lieber vorlesen. Da wird wieder gejohlt. Welche politische Situation in Deutschland allerdings das Abspielen einer Videobotschaft verunmöglicht, während sie umstandslos vorgelesen werden kann, bleibt unklar.
Es ist eine Anklageschrift mit den üblichen Punkten, die sich allesamt ausschließlich gegen Israel richten. Dass sie von den neueren Entwicklungen, einem fragilen, aber doch lebensrettenden Waffenstillstand etwa, nichts zu wissen scheint, wird wohl kein Zufall sein. Freiheit gebe es immer nur für alle, liest Li vor, ob sie nun queer oder Palästinenser seien. Ein Zwischenruf, der in Erfahrung bringen will, ob das auch für Juden gelte, bleibt unbeantwortet. Die verlesene Forderung nach Freiheit für Palästina wird von einer Minderheit im Publikum touchiert mit dem Appell, Palästina von der Hamas zu befreien. Derlei Eingaben sind aber nicht gewünscht und werden alsbald mit der Bitte um einen »respektvollen Austausch« abmoderiert. Das Ganze endet dann mit der unvermeidlichen und allgegenwärtigen, wenn auch unter anderem in Berlin als strafbar eingestuften Parole: »From the river to the sea / Palestine shall be free«. Die Mehrheit im Saal ist ganz aus dem Häuschen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im identitätspolitischen Furor wird auch der verworrene und komplexe Krieg in Nahost runtergebrochen auf eine Schulhofschlägerei: Für Jun Li sind die Identitäten jedenfalls mehr als eindeutig, die Guten hier, die Bösen da. Viel Pathos und Aufregung für denkbar schlichte Einsichten.
Zur Wahrheit über diesen Premierenabend gehört aber auch, dass dem politisch unbedarft wirkenden Jun Li mit »Queerpanorama«, seinem dritten Langfilm, eine äußerst sensible, traurig-poetische und mal vorsichtig tastende, mal unnachgiebig bohrende Erzählung fürs Kino gelungen ist. Sein eindrucksvoller Hauptdarsteller Jayden Cheung spielt einen jungen schwulen Mann in Hongkong, der sich von One-Night-Stand zu One-Night-Stand bewegt.
Auf sehr unterschiedliche Männer trifft Cheung in diesem Film. Von einem zum nächsten der intimen Treffen rettet er etwas von seinen Kurzzeitbegegnungen hinüber. Er nimmt für die ohnehin fast anonymen Verabredungen einen Teil der Identität seiner Sexualpartner an, vielleicht den Namen, den Beruf oder die Herkunft, vielleicht auch eine Marotte im Bett. Dabei kann er auf nur wenige Eindrücke zurückgreifen, die er zwischen schnellem Sex und reduzierten Dialogen gewinnt.
Der knapp eineinhalbstündige Film bleibt trotz der reduzierten Handlung aufregend. Über die Chronologie dieses Reigens lässt der Regisseur die Zuschauer auf kluge Weise im Unklaren. Und was die Hauptfigur jeweils erwartet, bleibt überraschend. Kein Stück Pornografie läuft über die Leinwand, eher eine Dokumentation über die verzweifelt und kaum erfüllbare Suche nach Lust und Nähe. Nicht jedes Treffen endet auch nur körperlich erfüllend. Abstürze werden sichtbar, wenn auch nicht voyeuristisch ausgestellt. Auch Missbrauch scheint unausweichlich.
Die Idee dieser Art »stille Post« für schwule Erwachsene hätte auch einen ganz anderen, einen heiteren Film ergeben können. Jun Li präsentiert uns vor allem die erdrückende Einsamkeit seiner Figuren. Soundtracklos und in Schwarz-Weiß. Bruchstücke aus den Biografien suchender Menschen erfahren wir. Ob hier irgendjemand weniger Darsteller ist als die imitationswütige Hauptfigur, wissen wir nicht. Alles scheint gelogen, aber doch recht nah an der traurigen Wahrheit. Jeder ist ein Performer, unleugbar auch dann, wenn doch eigentlich Intimität im Spiel ist. Der authentische Sexualpartner ist eine Fiktion.
Dadurch dass Li, abgesehen von seinem Hauptdarsteller, alle Figuren mit Laien besetzt und deren eigene Erfahrungen ins Drehbuch aufgenommen hat, verleiht er seinem Film einen doppelten Boden. Denn hier spielen Menschen sich selbst, was eben eine vermeintliche Echtheit, allen denkbaren Erwartungen zum Trotz, nicht erzeugen kann. Das Denkmal Identität ist längst eingerissen, wir sehen auch im Film nur die Trümmer.
Bedauerlich, dass dieser aufwühlende Film durch politische Vereinfachungen gerahmt worden ist.
»Queerpanorama«: USA, Hongkong, China 2025. Regie/Buch: Jun Li. Mit Jayden Cheung, Erfan Shekarriz, Sebastian Mahito Soukup, Arm Anatphikorn und Zenni Corbin. 87 Minuten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.